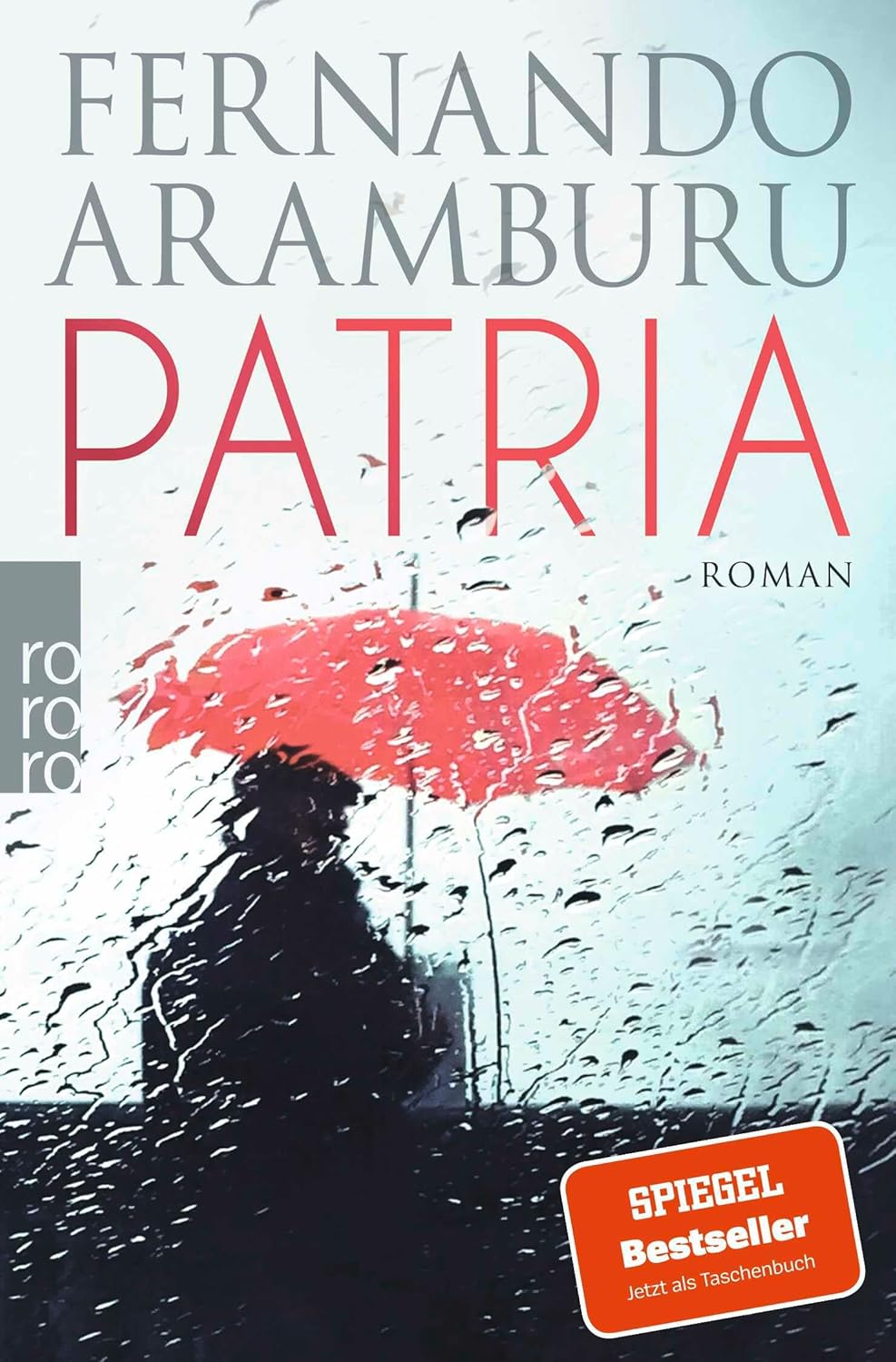
„Patria“ von Fernando Aramburu
Vor langer Zeit hatte das Buch als Medium mit Unterhaltungsauftrag noch weniger Konkurrenz und die Kundschaft war geduldig. Die Autoren konnten sich einen langsamen Anfang leisten, der dich nicht bereits mit dem ersten Satz aus den Sandalen katapultiert sondern einlädt, eine narrative Savanne zu durchqueren, in der zunächst vor einer Kulisse der Banalitäten in aller Ruhe die Figuren und der Schauplatz vorgestellt werden. Dabei passiert wenig, oder dem Leser ist das Geschehen in seiner Tragweite noch nicht verständlich.
So beginnt nach meinem Empfinden „Patria“. Sehr langsam für einen modernen Roman. Sehr allmählich. Mit vielen Alltagskonversationen, die helfen, sich an die Stimmen der zentralen Handlungsträger zu gewöhnen, neun an der Zahl. Die Spannung entsteht erst, als die Witwe eines von ETA ermordeten Unternehmers beschließt, das vor langer Zeit verlassene Haus in ihrem Heimatdorf regelmäßig zu besuchen. Kurz zuvor hatte die baskische Terrorgruppe die Waffen niedergelegt, und nun also der Test, wie der Frieden funktioniert unter den normalen Bürgern.
Dieser Akt – eine alte Frau kehrt in ihren Heimatort zurück – entbehrt natürlich jeglicher Banalität, und man versteht das in seiner ganzen Tragweite erst mit der Zeit. Denn faktisch alle Bewohner, Nachbarn und sogar Freunde waren direkt oder indirekt Komplizen des Mordes an ihrem Ehemann. Aus Überzeugung, aus Opportunismus oder aus Feigheit. Sie haben die Mörder mit Informationen versorgt, oder sie haben weggesehen, haben die Familie brutal ausgefroren, als von den Rettern der Heimat, der „Patria“, die Order kam: Dieser Mann, bis dahin ein angesehener Bürger des Städtchens, ist ein Feind der Basken.
Aramburu beschreibt, wie das biedere Umfeld, lauter „aufrichtige Patrioten“, eine Zielscheibe auf den Rücken eines anständigen Mannes zeichnet. Und schildert, wie die neun Protagonisten mit der Katastrophe umgehen. Gegen das Ende dieses Romans hin habe ich zeitweise vergessen, wie Atmen geht. Fernando Aramburu erzählt mit unaufdringlicher handwerklicher Brillanz das Schicksal zweier baskischer Familien, die seit jeher eng befreundet sind, bis es plötzlich beginnt: ETA verlangt von dem Unternehmer finanzielle Unterstützung, die so genannte „Revolutionssteuer“. Wer nicht zahlt, outet sich als „Spanier“. Etwas Schlimmeres kann man damals, in der „Blütezeit“ von ETA und einem in anderer Weise aber ebenso brutalen Umfeld, nicht genannt werden.
Die Tragödie nimmt ihren Lauf, zunächst „gewaltlos“, mit verleumderischen Wandschmiereien, erst vereinzelt, dann im ganzen Ort. Auf der Straße wagt niemand mehr zu grüßen, selbst gute Freunde wenden sich ab. Währenddessen ist ein Mitglied der anderen Familie in den Sog der „Freiheitskämpfer“ geraten, beteiligt sich zunächst an den damals typischen Straßenaktionen, deren Markenzeichen das Anzünden von Linienbussen war, und wird schließlich zum Untergrundkämpfer. Zum Mörder.
Bis es dann passiert.
Es gehört zum Ritual der ETA-Morde, dass die Familien der Opfer ebenfalls ausgegrenzt werden. In den kleineren Orten, wo jeder jeden kennt, kommen nur die ganz Mutigen zum Begräbnis. Wenn überhaupt jemand. Nicht einmal die Toten werden in Ruhe gelassen. „Patrioten“ verunstalten die Gräber mit Parolen, damit niemand auf die Idee kommt, so etwas wie Mitgefühl aufzubringen. Die Familie des Ermordeten hat keine Wahl, sie zieht in eine große Stadt, oder besser: flüchtet, um dem faschistoiden Muff und dem Psychoterror der sich als links gerierenden „Abertzale“ zu entgehen.
Aramburu navigiert den Leser durch diese Landschaft der menschlichen Abgründe mit ruhiger Stimme. Obwohl Baske und durch den ETA-Mord eines von ihm verehrten Intellektuellen persönlich betroffen, beachtet er das von der Journalistin und Schriftstellerin Bloor Schleppey geprägte Bonmot, dass es mit geballten Fäusten schwer fällt, Schreibmaschine zu schreiben. Wenngleich er seine Figuren gelegentlich die Erzählung übernehmen lässt und unvermittelt in die Ich-Form wechselt, bewahrt er eine Distanz, die der Geschichte zusätzliche Kraft verleiht. Dabei vergisst er auch nicht die Brutalität der Gegenseite, die Folterverbrechen der Guardia Civil, verzichtet jedoch auf moralische Urteile, schildert nur, gibt sich unendlich Mühe nachzuvollziehen, warum die Menschen damals so gehandelt haben, und überlässt dem Leser die Entscheidung, was davon zu halten ist.
Für diesen Zweck versieht die große Geschichte mit vielen kleiner Geschichten. Anekdoten, pointierter Dialoge und Miniaturen machen das Fühlen auf beiden Seiten dieser Front nachvollziehbar. Ich möchte zwei davon vorstellen:
Die Witwe wird bald nach ihrem ersten Besuch im Heimatort vom Pfarrer aufgesucht. Dieser schützt triviale Konversation vor, kommt jedoch bald zu seinem Anliegen: Sie möge doch bitte in Hinkunft fernbleiben. Ihre Anwesenheit löse Unruhe aus, die Bewohner fühlten sich verstört, sie solle deren Gefühle respektieren. Das Grandiose an dieser Szene: Mit demselben Argument weigerte sich die spanische Rechte jahrzehntelang und punktuell bis heute, die im Bürgerkrieg exekutierten und in anonymen Massengräbern verscharrten „Linken“ exhumieren und würdig bestatten zu lassen. Um die Gesellschaft „nicht aufzuwühlen“. Aus Rücksicht auf die Gefühle der Familien der damaligen Täter. Darüber hinaus baut Aramburu hier einen Fingerzeig auf die katholische Kirche ein, die den gewalttätigen Nationalisten im Baskenland weitgehend eine zuverlässige moralische Stütze war, allen voran José María Setién, der Bischof von San Sebastián.
Schließlich die Episode, als die Familie des nunmehr inhaftierten ETA-Terroristen auf dem langen Weg zum Gefängnisbesuch mit dem Auto verunglückt und von einem freundlichen Spanier – einem Spanier! – Hilfe erhält. Die Familienmutter, eine eisenharte Verfechterin der Ideologie des bewaffneten Kampfes, fühlt sich verpflichtet, dem Mann aus Dankbarkeit ein Geschenkpaket zukommen zu lassen. Aber nie, nie im Leben wird sie dieses Paket im Postamt ihres Dorfes aufgeben, es könnte sich ja herumsprechen, dass sie mit einem „Spanier“ zu tun hat, daher reist sie dafür extra in die Stadt. Was werden die Leute sagen – eines der treibenden Motive dieser Geschichte und des menschlichen Handelns im Allgemeinen, auf die Spitze getrieben in einer Situation, in der jede noch so kleine Geste der Menschlichkeit als Verrat angeprangert werden kann.
(Ich muss spontan an arabische Sportler denken, die sich weigern, ihrem israelischen Gegner die Hand zu reichen. „Was werden meine Leute sagen …“).
Ich habe das Buch im spanischen Original gelesen und kann deshalb über die Qualität der deutschen Übersetzung nicht urteilen. Das erwähne ich, weil mir Aramburus origineller Sprachgebrauch gefällt, voll mit wundervollen und in meinen Ohren sehr spanischen Formulierungen, die stets im Dienst der Geschichte und ihrer Figuren stehen. Kaum vorzustellen, dass in der Übersetzung davon nichts verloren geht. Egal, denn die Essenz hat ausreichend Gewicht, um „Patria“ als Meisterwerk in jeder denkbaren Sprache zu etikettieren. Es ist schon länger her, dass mich ein Roman so tief bewegt hat. Damit stehe ich nicht allein. Das Buch – mit Preisen überhäuft, in Deutschland ein Spiegel-Bestseller – wurde auch zur Grundlage einer viel beachteten HBO-Serie.
MEIN LIEBLINGSZITAT
Die Rückkehr der Witwe wird im Dorf umgehend zum Gespräch. So auch zwischen dem ehemals besten Freund des Ermordeten und seiner stramm nationalistischen Frau. Er berichtet, dass er spät abends Licht in der Wohnung von „denen“ (die Familie des Opfers) gesehen habe. Darauf die Frau: „Jetzt, wo der bewaffnete Kampf vorbei ist, werden sie unverschämt.“
NEBENBEI ERWÄHNT
Vor gut einem Vierteljahrhundert leitete ich die redaktionelle Arbeit einer Hotelzeitschrift, die zweimal im Jahr erschien und ihren Lesern neben Reportagen über die Standort-Regionen auch jeweils eine Kurzgeschichte bot. Zu den ersten Schriftstellern, die ich zur Mitarbeit einlud, gehörte Fernando Aramburu. Um ehrlich zu sein: Die Story, die er ablieferte, hat mich unterwältigt. Eine routiniert heruntergeschriebene Auftragsarbeit ohne erzählerische Ambition, bar jeglicher Originalität. Vielleicht habe ich deshalb so lange gezögert, „Patria“ zu lesen. Ich hake die Kurzgeschichte als Ausrutscher ab: Er war jung und brauchte das Geld …
