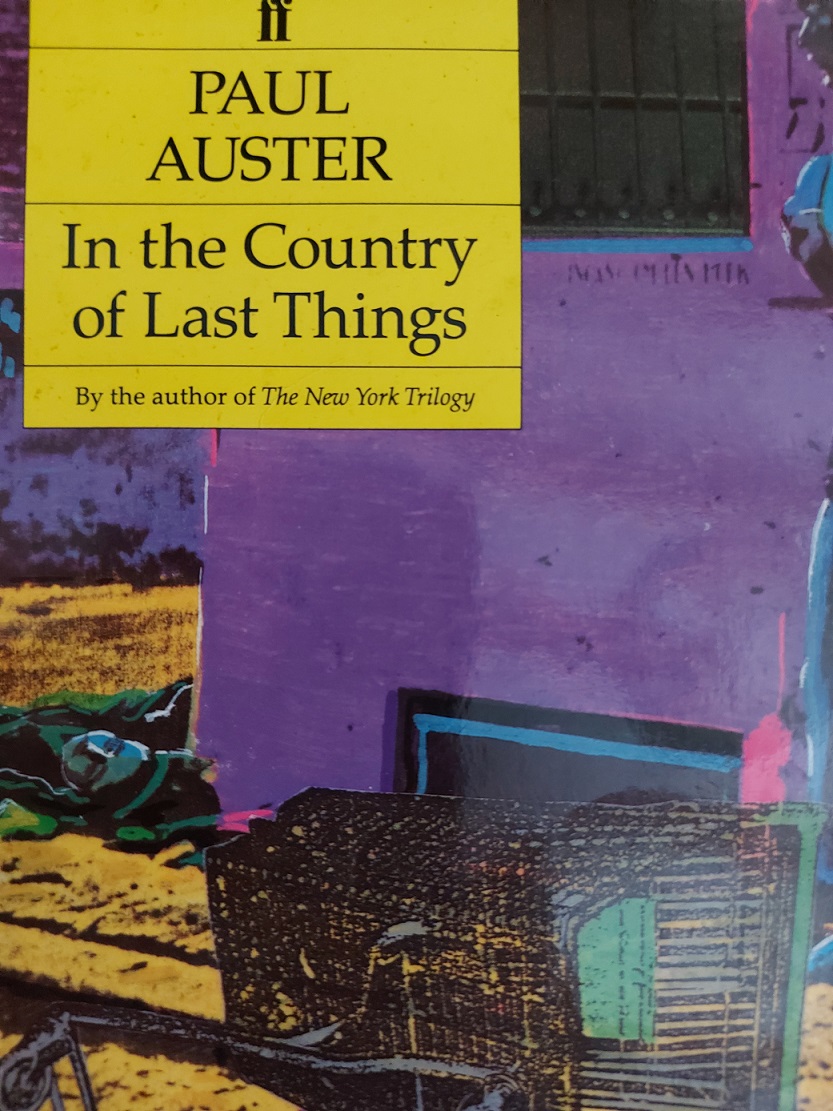
„Im Land der letzten Dinge“ von Paul Auster
Das Ironische an meinem Zugang zu Paul Auster war, dass ich seine Literatur ausgerechnet über sein untypischstes Buch kennenlernte. „In the Country of Last Things“ ist eine Dystopie, manche sehen den Roman als Science Fiction. Dafür ist der Autor nun wirklich nicht bekannt. Kurioserweise ist dieser relativ kurze und eminent atypische Roman bis heute mein Lieblings-Auster. Was angesichts der durchaus gemischten Kritiken ebenfalls kurios ist. Der Spiegel jedenfalls hat das Buch aus Anlass des Todes des Schriftstellers nicht in den Kanon der „Fünf Besten“ aufgenommen. Eine mögliche Erklärung findet sich in manchen Kritiken, die sich schwertun, dieses Werk zu kategorisieren. Aber wenn Kritiker für ein Buch keine Schublade finden, kann das auch ein Merkmal für Originalität sein. Schlechte Kritiken führen vielleicht auf den Ärger der Kritiker zurück, dass sie keine Schublade gefunden haben. Kritiker lieben Schubladen.
Das Problem ist vielleicht auch, dass dieser Roman direkt nach Austers erstem großen Erfolg erschien, „The New York Trilogy“. Danach wartete jeder auf einen weiteren „typischen Auster“. Und dann kam das.
Die Handlung: Eine junge Frau begibt sich auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder, der als Reporter entsandt wurde, in eine nicht genannte Stadt, die von der Umwelt abgeschnitten ist und im Chaos versinkt. Über ihre Abenteuer an diesem Ort schreibt sie einen Brief, der – und das ist wiederum typisch Auster – das Rückgrat der Erzählung darstellt. Vielleicht ein Trick, weil er sich schwer damit tat, eine Ich-Erzählung aus weiblicher Perspektive zu verfassen.
Das Besondere an der namenlosen Stadt, hinter der man unwillkürlich New York vermutet: Hier kämpfen Menschen in einer postapokalyptischen Gesellschaft ums Überleben. Nichts wird mehr produziert, die Ordnung ist zusammengebrochen, man rettet sich von Tag zu Tag und versucht zu ergattern, was an Überresten der Zivilisation noch vorhanden ist. Inmitten dieser Katastrophenlandschaft bestehen Oasen der Ordnung und Hoffnung, die jedoch auf Dauer dem Untergang geweiht sind.
Paul Auster ist kein Science-Fiction-Autor, die Ursachen der Situation interessieren ihn ebenso wenig wie Technologie oder Politik. Ihn interessiert das Individuum, der Einzelne, in diesem Fall die Heldin mit dem nicht zufällig jüdischen Namen Anna Blume.
Was mich an dem Roman fasziniert: Die hypnotische Qualität des Erzählens, das Unvorhersehbare, die mit unglaublicher sprachlicher Ökonomie geschilderte Atmosphäre und dann natürlich Austers Fähigkeit, dem Phänomen Schicksal auf eine gleichzeitig kühle und poetische Weise auf den Grund zu gehen. Das macht er auch in seinen anderen Büchern, in denen Zufälle – das Unvorhersehbare – hinter jeder Ecke lauern und daher die Handlung dem annähern, was wir als Leser in unserer Existenz immer wieder erleben. Die Macht des Zufalls, die Willkür des Schicksals. Die Todfeinde mittelmäßiger Schriftsteller, die sich angesichts der Gefahr der unglaubwürdigen Zufälle und Schicksale ins Vorhersehbare retten.
Auster bändigt genau diese Element und hilft dem Leser, mit ihnen seinen Frieden zu schließen. Und ich bin NICHT der Meinung, dass „In the Country of Last Things“ schlecht geschrieben ist, wie einige Kritiken behaupten. Austers kristalline Prosa geht runter wie guter Wein.
MEIN LIEBLINGSZITAT
The irony was that Sam was a success in his role as doctor. All the props were there for him – the white coat, the black bag, the stethoscope, the thermometer – and he used them to full effect. There was no question that he looked like a doctor, but after a while he began to act like one, too. That was the incredible part of it.
NEBENBEI ERWÄHNT
Während meiner kurzlebigen Karriere als Buchverkäufer in einer deutschen Buchhandlung in Palma de Mallorca wurde ich oft um Rat gebeten, mit welchem Buch man als jemand, der eine Fremdsprache lernt, seinen ersten Lektüre-Versuch starten sollte. Den spanischen Deutsch-Studenten empfahl ich „Das Versprechen“ von Dürrenmatt, weil spannend, was den Leser motiviert, die Vokabel-Hürden zu nehmen, und weil die enorme literarische Qualität aus einer extrem simplen Sprache entsteht, weshalb die vokabularischen Hürden von erträglicher Höhe sind. Den Englisch Lernenden empfahl ich „In the Country of Last Things“. Aus genau demselben Grund.
