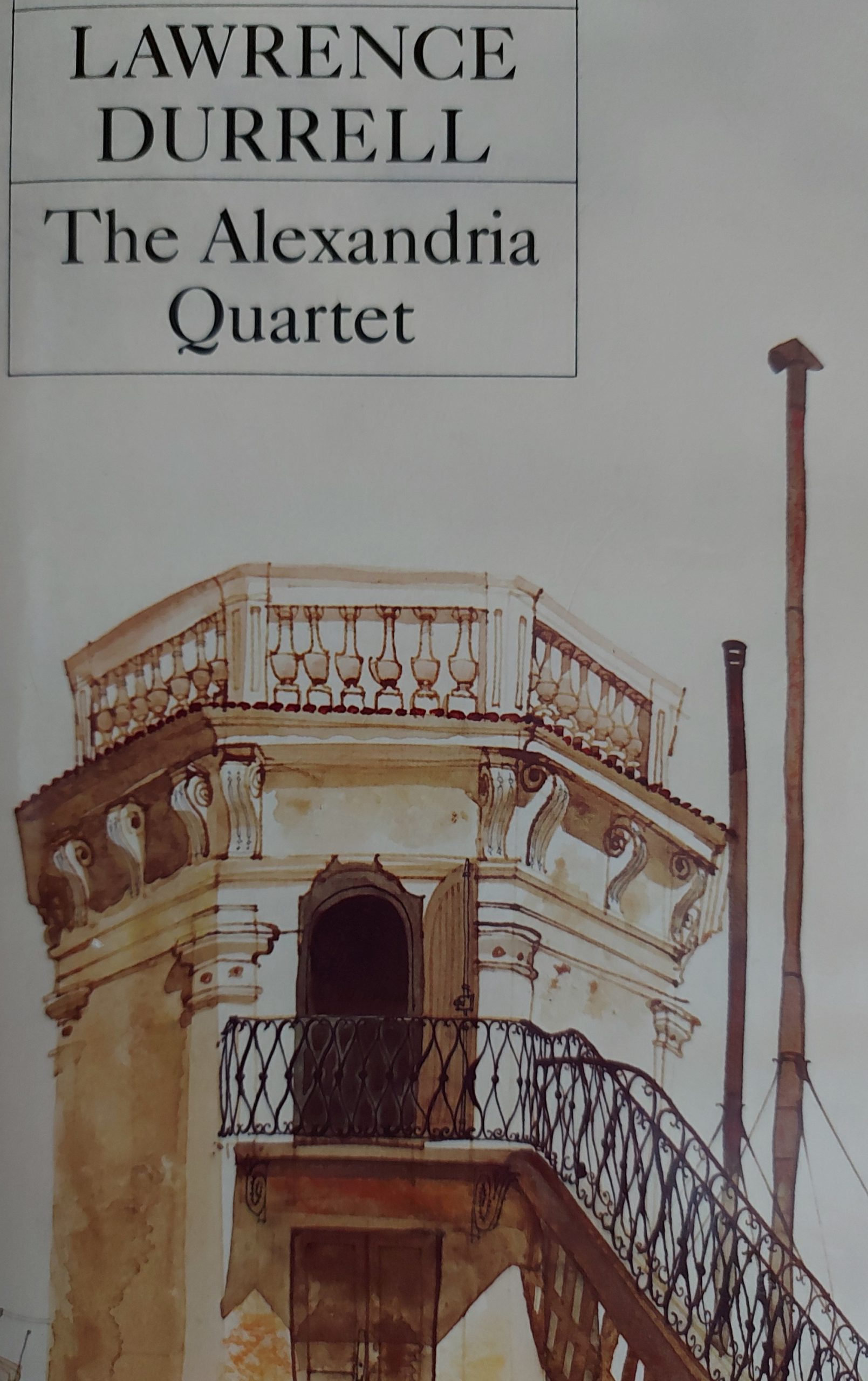
„The Alexandria Quartet“ von Lawrence Durrell
Viele Jahre hindurch habe ich praktiziert, was ich den „Alexandria-Test“ nenne. Wenn mir der Sinn danach stand, etwa einmal pro Woche, nahm ich die 877 Seiten starke Taschenbuchausgabe von Faber and Faber aus dem Regal, die alle vier Bücher der englischen Originalfassung des „Alexandria-Quartetts“ von Lawrence Durrell in einem Monsterband vereint. Dann schlug ich eine beliebige Seite auf und las sie. Und hatte immer das Gefühl, eine besonders gute Seite aufgeschlagen zu haben. Immer. Jede Seite, die ich den Zufall wählen ließ, enthielt ein Juwel der Schreibkunst, zumindest einen Satz, eine Formulierung, bei der ich den Atem anhielt und dachte: Wie muss es im Kopf eines Menschen aussehen, der so gut schreiben kann!?
Der Mythons dieses Buchs – dieser Bücher – gründet somit nicht alleine auf der genialen Grundidee: Dieselbe Geschichte, erzählt in vier Romanen aus den Perspektiven jeweils einer anderen Person, die uns als Protagonist präsentiert wird und dem Buch ihren Namen gibt: Justine, Balthazar, Mountolive, Clea. Jeder Roman ist ein Meisterwerk für sich, doch sind die vier Bücher kunstvoll miteinander verwoben, tauchen die Personen aus einem Roman im aderen wieder auf, manchmal ereignen sich dieselben Szenen, nun betrachtet aus einer vollkommen neuen Perspektive.
Dann der Geniestreich: Erst mit dem letzten Buch – Clea – ergeben auch die anderen drei auf einer bis dahin unsichtbaren Erzählebene tieferen umfassenden Sinn. Wird klar, dass wir uns die ganze Zeit in einem gigantischen Labyrinth bewegt haben.
Angesiedelt ist „The Alexandria Quartet“ in dieser großen Hafenstadt in Ägypten am Lebensabend des Britischen Empire, als sich eine neue Weltordnung zu formieren beginnt. So tragisch die Übergangsphasen der Menschheit sind, so schwer fällt es, sich der Faszination ihrer atmosphärischen Dichte zu entziehen. Wir wissen das, leben wir doch selbst in einer „atmosphärisch dichten“ Zeit …
Der in Indien geborene Brite Durrell (1912-1990) fängt diese Atmosphäre ein und wählt als Schauplatz einen historischen Treff- und Schnittpunkt der Kulturen. Ich frage mich, ob Durrell gelegentlich Angst hatte vor der Dimension seiner Idee, ob ihm in den Sinn kam, er könne sie vergeigen. Denn nur ein wirklich großartiger Autor kann eine so großartige Idee würdig umsetzen.
Doch von der Rückseite des Buchs lächelt verschmitzt ein schon älterer Herr mit Seemannsmütze und man gewinnt den Eindruck, der fühlt sich seiner Gaben so sicher als wäre er die Schreibmaschine des lieben Gotts.
MEIN LIEBLINGSZITAT
Dieser Eindruck wird von einem kuriosen Detail verstärkt, das ich in keinem anderen konventionellen Roman gesehen habe: Der Autor hält mitten in der Erzählung inne, um seiner Begeisterung über einen besonders gelungenen Satz Ausdruck zu verleihen, mit Augenzwinkern, aber er tut es, und das Erstaunlichste: Der Lektor lässt es durchgehen!!! Wir sprechen von einem Werk, dessen vier Bestandteile zwischen 1957 und 1960 Premiere feierten. Waren die lockerer damals? Aber möglicherweise war der Lektor an diesem Punkt ohnehin schon derselben Meinung. Die beiden, Autor und Lektor, hatten wahrscheinlich ihren Spaß mit diesem Ausbruch aus der Fiktion, der auch den Leser nicht stört, weil er sich wie ein Komplize dem Schmunzeln anschließt, ja beinahe an den Tisch gerufen fühlt, um gemeinsam mit Autor und Lektor auf eine großartige Zeile anzustoßen.
Leute, ich habe das 877-Seiten-Buch, gelesen vor mehr als 20 Jahren, noch einmal durchgeblättert, um genau diese Stelle aufzuspüren. Für Euch! Und habe sie gefunden, die Nadel im Heuhaufen. Feierlich nehme ich den metaphorischen Hut ab, rolle den metaphorischen roten Teppich aus und zitiere wortwörtlich aus dem Buch “Balthazar”, Teil III: „The flocks of spring pigeons glittered like confetti as they turned their wings to the light. (Fine writing!)”
“Fine writing“ – das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kenne das Glücksgefühl, wenn mir gelungen ist, was ich für einen richtig guten Satz halte. Das passiert mir sehr viel seltener als Lawrence Durrell, der mit seinem Meisterwerk auch Schaden anrichtet: 1) traue ich mich seit „The Alexandria Quartet“ nichts mehr von Durrell zu lesen, weil ich fix davon ausgehe, dass es mich nach dieser Lektüre enttäuschen muss, und 2) fühle ich mich als Autor manchmal entmutigt, wenn einer über 877 Seiten scheinbar mühelos dieses Niveau hält, als wäre ich ein Marathonläufer, an dem ein nie ermüdender Sprinter vorbeihoppst. Wobei wir Autoren alle wissen, wie viel Plackerei hinter diesem Anschein von Mühelosigkeit steckt.
NEBENBEI ERWÄHNT
Durrell wollte dem „Alexandria Quartet“ noch eins draufsetzen und schrieb das „Avignon Quintet“, also fünf Bücher nach derselben Grundidee, diesmal nicht in Ägypten angesiedelt, sondern in seiner späteren Wahlheimat Frankreich, aber fragt mich nicht, wovon sie handeln, ich hatte bisher nicht den Mumm, sie zu lesen.
 |
 |
